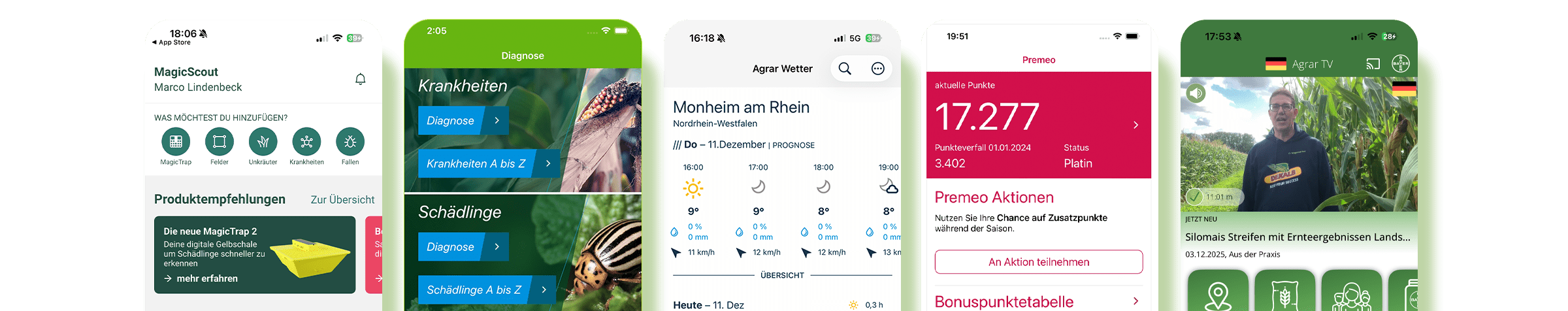-
A
-
B
-
C
-
D
- Decis® forte
- Delaro® Forte
- Delion®
- DK Exaura
- DK Exbury
- DK Excited
- DK Expectation
- DK Expose
- DK Plasma
- DKC 2788
- DKC 2891
- DKC 2972
- DKC 2990
- DKC 3012
- DKC 3117
- DKC 3201
- DKC 3218
- DKC 3305
- DKC 3323
- DKC 3327
- DKC 3350
- DKC 3400
- DKC 3414
- DKC 3418
- DKC 3419
- DKC 3434
- DKC 3438
- DKC 3450
- DKC 3474
- DKC 3513
- DKC 3539
- DKC 3575
- DKC 3601
- DKC 3609
- DKC 3642
- DKC 3710
- DKC 3719
- DKC 3888
- DKC 3924
- DKC 3939
- DKC 3990
- DKC 4038
- DKC 4070
- DKC 4109
- DKC 4162
- DKC 4279
- DKC 4320
- DKC 4416
- DKC 4603
- DKC 4611
- DKC 4712
- DKC 4908
- DKC 4943
- DKC 5092
- DKC 5110
- DKC 5206
- DKC 5542
- DMH 585
- DMH591
- DURANO®TF
-
F
-
G
-
H
-
I
-
L
-
M
-
P
-
R
-
S
-
T
-
D
- DK Exaura
- DK Exbury
- DK Excited
- DK Expectation
- DK Expose
- DK Plasma
- DKC 2788
- DKC 2891
- DKC 2972
- DKC 2990
- DKC 3012
- DKC 3117
- DKC 3201
- DKC 3218
- DKC 3305
- DKC 3323
- DKC 3327
- DKC 3350
- DKC 3400
- DKC 3414
- DKC 3418
- DKC 3419
- DKC 3434
- DKC 3438
- DKC 3450
- DKC 3474
- DKC 3513
- DKC 3539
- DKC 3575
- DKC 3601
- DKC 3609
- DKC 3642
- DKC 3710
- DKC 3719
- DKC 3888
- DKC 3924
- DKC 3939
- DKC 3990
- DKC 4038
- DKC 4070
- DKC 4109
- DKC 4162
- DKC 4279
- DKC 4320
- DKC 4416
- DKC 4603
- DKC 4611
- DKC 4712
- DKC 4908
- DKC 4943
- DKC 5092
- DKC 5110
- DKC 5206
- DKC 5542
- DMH 585
- DMH591
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
G
-
H
-
I
-
L
-
M
-
P
-
R
-
S
-
T
Agrar Magazin / Resistenzmanagement
Anröchte 1.0 – die Ergebnisse
Anröchte 2.0 – neue Zielsetzung
Zwischen 2018 und 2022 ging es im Wesentlichen darum, den in Anröchte 1.0 aufgebauten Besatz mit Ackerfuchsschwanz durch verschiedene Strategien in den Griff zu bekommen und für verschiedene Ausgangssituationen passende Lösungsansätze zu entwickeln. Daran angelehnt wurden vier Versuchsfragen formuliert, die Jule Vorholzer, Market Development Manager Herbizide bei Bayer CropScience, erläuterte.
- Lässt sich mit der Bayer Anti-Resistenzstrategie eine Resistenzentwicklung beziehungsweise der Populationsaufbau bei Ackerfuchsschwanz auf weitere vier Jahre vermeiden?
- Welchen Effekt hat der Anbau von Weidelgras auf die Reduktion des Bodensamenvorrates?
- Kann –auch in Parzellen mit hohem Ausgangsbesatz –das Bodensamenpotenzial durch ackerbauliche Maßnahmen reduziert werden (Scheinsaat und Erweiterung der Fruchtfolge)?
- Kann auf den Einsatz von Glyphosat UND Pflug verzichtet werden, indem man den Anteil an Sommerungen auf 50 Prozent erhöht?
Im Gegensatz zum ersten Projektteil wurde von 2018 an in allen Varianten ein maximaler, kulturbezogener Einsatz von Herbiziden gefahren. Im Beispiel Weizen war das: Glyphosat vor der Aussaat, Herbstbehandlung mit Mateno Forte Set und Boxer und eine Frühjahrsnachlage mit Atlantis Flex (0,33 kg/ha) + Biopower (1 l/ha) und AHL (30 l/ha).
Auch wenn die Endauswertung noch nicht möglich ist, da die Daten für 2022 noch fehlen, können erste Zwischenfazits gezogen werden. So hat es sich gezeigt, dass es keine Allround-Lösung bei der Ackerfuchsschwanz-Kontrolle gibt. Die Lösungsansätze präsentierten sich situationsbezogen. Grundsätzlich bilden vorbeugende ackerbauliche Maßnahmen die Basis einer erfolgreichen Ackerfuchsschwanzbekämpfung. Diese sind etwa ein verspäteter Saattermin, der Einbau von Sommerungen in die Fruchtfolge, eine verstärkte Bodenbearbeitung und die Nutzung verschiedener Wirkstoffgruppen. Damit lässt sich ein Ackerfuchsschwanz-Ausgangsbesatz auf einem niedrigen Niveau halten, was die langfristige Wirksamkeit der Herbizidmaßnahmen absichert. Auch wenn diese Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes schon lange bekannt sind – in Anröchte werden sie dem Besucher Schwarz auf Weiß vor Augen geführt. Auf Sanierungsflächen müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um ein weiteres Aussamen zu verhindern, notfalls ist eine mehrjährige Stilllegung Ackerfuchsschwanz-verseuchter Flächen das Mittel der Wahl. Hier führten bereits wenige Jahre der Futtergrasnutzung dazu, den Ausgangsbesatz von weit über 1.000 Ackerfuchsschwanz-Ähren deutlich zu reduzieren.